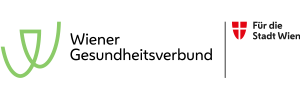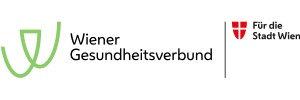WIGEV zum Monat der Hautgesundheit
Schwarzer Hautkrebs – Ein vielversprechender Ansatz und die größten Herausforderungen Der Mai ist das Monat der Hautgesundheit. Ein Aufklärungsmonat, mit dem der Kampf gegen die im Volksmund „schwarzer Hautkrebs“ bezeichnete Krankheit, das Melanom, vorangetrieben werden soll. Denn die Zahlen steigen – international und auch in Österreich. Während der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) im Jahr 2018 noch 1.364 Patient*innen mit einem Melanom behandelte, waren es 2024 bereits 1.855 – ein Anstieg um über ein Drittel innerhalb weniger Jahre. Am häufigsten ist die Altersgruppe zwischen 50 und 74 Jahren betroffen, Männer und Frauen weitgehend gleich oft. „Wir müssen das Bewusstsein für diese Erkrankung möglichst breit stärken – und den Menschen auch die Werkzeuge in die Hand geben, um Melanome frühzeitig zu erkennen“, sagt Christian Posch, Abteilungsleiter der Dermatologie in den Kliniken Hietzing und Landstraße. „Sie müssen wissen, worauf sie achten sollen, und im Verdachtsfall rasch den Weg zu den Dermatolog*innen finden.“
Weltweit steigen die Zahlen an Hautkrebs-Erkrankungen. Warum es dennoch Grund zur Hoffnung gibt und wie der Wiener Gesundheitsverbund gegensteuert.
Hautkrebs selbst erkennen
Als wichtiges Instrument zur Selbsteinschätzung gilt die ABCDE-Regel, anhand derer tendenziell zwischen harmlosen Muttermalen und potenziellen Melanomen unterschieden werden kann.
- A steht in der Formel für Asymmetrie: Zieht man einen Strich durch die Läsion und die beiden Hälften sind nicht deckungsgleich, ist das auffällig.
- B bezieht sich auf die Begrenzung: Ist es schwierig, das Muttermal klar abzugrenzen und ändert sich die Kontur laufend – mal scharf begrenzt, mal verschwommen – besteht ebenfalls ein Verdacht.
- C steht für die Farbe: Zwei Farben sind meist unbedenklich, drei oder mehr können ein Warnzeichen sein.
- D ist der Durchmesser: Ein schwaches Kriterium, aber größere Flecken (>5mm) sind als auffällig zu werten.
- E steht für Entwicklung: Veränderungen sind das zentrale Kriterium, die eine dermatologische Abklärung nötig machen. Das kann eine Farbänderung, Blutung, oder Größenzunahme sein.
Die Haut als Bankkonto
Aber was genau ist eigentlich ein Melanom? „Das Melanom ist ein Hauttumor, der von den pigmentbildenden Zellen der Haut entsteht, also jenen Zellen, die unserer Haut eine braune Farbe verleihen. Wie alle Zellen können auch diese entarten und damit bösartig werden“, erläutert Posch. In der Dermatologie unterscheidet man zwischen schwarzen und weißen (bzw. nicht-schwarzen) Hauttumoren. „Diese Trennung ist deshalb so wichtig, weil der schwarze Hautkrebs – das Melanom – für die meisten durch Hautkrebs bedingten Todesfälle verantwortlich ist. Der nicht-schwarze Hautkrebs hingegen ist deutlich häufiger, führt aber vor allem zu lokalen Beschwerden und nur ganz selten zum Tod.“
Umso entscheidender ist die frühzeitige Erkennung: „Ein dünnes Melanom ist durch chirurgische Entfernung in mehr als 95 % der Fälle heilbar“, so Posch. Beim nicht-schwarzen Hautkrebs spielt die UV-Belastung eine zentrale Rolle – vor allem durch Sonnenstrahlung. „Man kann sich die Haut wie ein Bankkonto vorstellen, auf das man nichts einzahlen kann. Mit jedem Sonnenstrahl wird jedoch etwas abgebucht – und irgendwann ist das Konto leer“, betont Posch die Bedeutung von konsequentem Sonnenschutz.
Immuntherapie als Hoffnungsträger
Ein besonders vielversprechender Fortschritt in der Behandlung des Melanoms ist die Immuntherapie. „Das Melanom war der erste Tumor, bei dem wir zeigen konnten, dass ein immuntherapeutischer Ansatz funktioniert“, erklärt Posch. Der Tumor ist sehr immunogen – das Immunsystem erkennt ihn grundsätzlich gut, doch die Krebszellen schützen sich gezielt vor den Angriffen der körpereigenen Immunzellen. Medikamente können diese Mechanismen durchbrechen und das Immunsystem reaktivieren, damit es gegen die Tumorzellen vorgehen kann – mit großem Erfolg. Mittlerweile kommt die Immuntherapie nicht nur bei fortgeschrittenem Melanom, sondern auch in früheren Stadien der Erkrankung zum Einsatz – etwa zur Rückfallvermeidung nach der Entfernung des Tumors. Und: Auch die Reihenfolge der Behandlungsmaßnahmen wird immer relevanter. Bei Patient*innen mit Lymphknotenmetastasen verbessert eine sogenannte neo-adjuvante Therapie – also: zuerst Immuntherapie, dann Operation – die Heilungschancen um bis zu 20 %. „Ich spreche gerne von einer Ära des Timings“, betont Posch. „Gleiche Medikamente, gleicher Aufwand – aber bessere Ergebnisse.“