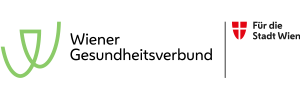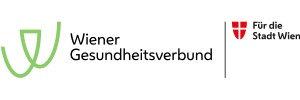Alzheimer-Medikament: Präzise Diagnostik als Schlüssel zur sicheren Behandlung
Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV), Österreichische Alzheimergesellschaft (ÖAG), Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM)): Erster Schritt führt zu Hausärzt*in
Etwa 150.000 Österreicher*innen leiden an einer dementiellen Erkrankung, bis 2050 wird sich diese Zahl auf etwa 260.000 erhöhen. Die Alzheimerdemenz ist mit etwa 60-70 % die häufigste Form einer Demenz. Bis zu 40 % der Demenzerkrankungen können durch Präventionsmaßnahmen verhindert werden. Dazu gehören regelmäßige körperliche Aktivität, kognitive Aktivierung wie Lesen oder Musizieren, soziale Interaktion und die Vermeidung von Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und unbehandelter Bluthochdruck und Diabetes.
„Menschen mit Demenz erhalten derzeit medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungen. Die Medikamente, die derzeit am Markt sind, behandeln Erkrankungssymptome, indem sie die Verfügbarkeit bestimmter Neurotransmitter erhöhen und so die kognitive Funktion vorübergehend stabilisieren. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie kann durch Gedächtnistraining, Ergotherapie, Bewegungstherapie und ähnlichen Maßnahmen die geistige Leistungsfähigkeit verbessert, Verhaltensstörungen gemildert und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden. Ziel ist, dass erkrankte Menschen ihren Alltag gut bewältigen können“, so Elisabeth Stögmann, Präsidentin der Österreichischen Alzheimergesellschaft.
Zulassung eines neuen Medikaments zur Therapie der Alzheimer-Erkrankung
Ein neues Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab wurde am 15. April 2025 in der EU zugelassen. In Österreich ist der Wirkstoff bereits verfügbar. Laut Herstellerangaben kann Lecanemab den Verlauf der Alzheimer-Demenz verlangsamen, stellt jedoch keine Heilung der Krankheit dar. Lecanemab kann die Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten um rund 30 % verlangsamen, ist jedoch nur für Patient*innen mit Alzheimer im Frühstadium indiziert, bei denen eine genetische Hochrisikovariante sowie weitere medizinische Kriterien ausgeschlossen wurden. Das Risiko von Nebenwirkungen (Hirnschwellungen, Hirnblutungen) erfordert engmaschige klinische und MRT-Kontrollen, die für die Patient*innen mit erheblichem zeitlichem Aufwand verbunden sind.
„Wir sorgen dafür, dass unsere Patient*innen eine Behandlung erhalten, die perfekt auf ihre Bedürfnisse und ihre Krankengeschichte zugeschnitten wird. Gerade bei Demenzerkrankungen ist daher eine exakte Diagnostik von enormer Bedeutung“, erklärt Michael Binder, Medizinischer Direktor vom Wiener Gesundheitsverbund.
Erste Schritte für Patient*innen
Hausärzt*innen sind die erste Anlaufstelle für Menschen, die abklären möchten, ob das neue Alzheimer-Medikament Teil Ihrer Behandlung sein kann. Nach der Erstuntersuchung erfolgt zur weiteren Abklärung die Überweisung an Neurolog*innen oder Psychiater*innen, die weiterführende Untersuchungen durchführen, um eine Eignung für diese Therapie zu bestimmen. Ein MRT soll kleine Gehirnblutungen ausschließen, da diese einen möglichen Risikofaktor für die Therapie mit Lecanemab darstellen.
Erst dann ist ein Besuch in einer spezialisierten Gedächtnisambulanz im Krankenhaus sinnvoll, um weitere spezifische Untersuchungen durchzuführen und die Therapiewahl mit den behandelnden Ärzt*innen zu besprechen.
Eine Empfehlung zum diagnostischen Vorgehen findet sich im Diagnosepfad der Österreichischen Arzheimer Gesellschaft (ÖAG).
Wirkungen und Nebenwirkungen
Lecanemab ist für Patient*innen geeignet, die an einer frühen Form einer Alzheimer-Erkrankung leiden, bei denen eine genetische Hochrisikovariante ausgeschlossen wurde, und die keine blutverdünnenden Medikamente einnehmen. Weitere Faktoren, die eine Eignung für das Medikament festlegen, müssen im Rahmen einer umfassenden Diagnostik untersucht werden. Das Medikament kann relevante Nebenwirkungen wie Gehirnblutungen oder Gehirnödeme verursachen. Die Patient*innen und ihre Angehörigen müssen deshalb über die potenziellen Risiken und den Behandlungsverlauf gut informiert sein. Bei der Entscheidung für eine Therapie mit Lecanemab ist eine intravenöse Gabe alle zwei Wochen notwendig. Dabei ist in den ersten 6 Monaten eine sehr engmaschige Überwachung der Patient*in erforderlich. Für den Therapieerfolg ist eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen Disziplinen und Einrichtungen von Bedeutung.
Weitere Kontakte: