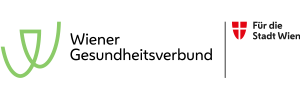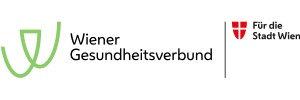Stille Geburt: Mama sein ohne Baby
Manche Familien erleben in der Schwangerschaft einen unvorstellbaren Verlust. Eine Stille Geburt oder Totgeburt ist medizinisch sehr selten, der seelische Schmerz stellt für die Betroffenen jedoch eine enorme Belastung dar – und wird in der Gesellschaft oft tabuisiert. „Totgeburt heißt, dass ein Kind mit einem Gewicht von mehr als 500 Gramm ohne Lebenszeichen geboren wird“, erklärt Ramona Sanani, Oberärztin und Leiterin der Geburtshilfe in der Klinik Landstraße. Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) setzen auf multiprofessionelle Teams, die betroffene Eltern begleiten – medizinisch, psychologisch und in rechtlichen sowie organisatorischen Fragen wie, Anspruch auf Wochenbettbetreuung, Namensgebung und Bestattung. „Denn auch ein verstorbenes Kind hat einen Platz in der Familie“, sagt Klara Laister, Klinische Psychologin in der Klinik Landstraße. Laister und Sanani betreuen Familien, deren Kind während der Schwangerschaft verstirbt.
„Ein Ungeborenes kann an einem Gendefekt oder einem Syndrom sterben. In den allermeisten Fällen lässt sich die Todesursache jedoch nicht feststellen. Selbst dann nicht, wenn das Kind nach der Geburt obduziert wird“, so Sanani. „Wenn die Frage nach dem Warum? nicht beantwortet werden kann, ist die Aufarbeitung und Bewältigung des Verlusts besonders herausfordernd.“
Neben der medizinischen Begleitung spielt die psychologische Unterstützung eine zentrale Rolle. „Eltern, die ein totes Kind zur Welt bringen, trauern um eine gemeinsame Zukunft, die es mit diesem Baby nie geben wird. Es ist wichtig, diesen Schmerz ernst zu nehmen, Gesprächsangebote zu machen und Raum für ein erstes Begrüßen und den Abschied zu schaffen. Eltern fragen sich, wir ihr Baby ausschauen wird? Wie klein es sein wird? Mit ehrlichen Informationen nehmen wir Ängste. Mit Fotos und Fußabdrücken des Babys schaffen wir Erinnerungen für die Familie“, erzählt Laister. Die Eltern werden nach der Geburt auf der Gynäkologischen Station und nicht auf der Neugeborenen-Station aufgenommen.
Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes bieten betroffenen Familien einen geschützten Rahmen, in dem medizinische, psychologische und organisatorische Unterstützung koordiniert zur Verfügung steht. Ziel ist es, Eltern in dieser besonderen Ausnahmesituation umfassend zu begleiten und eine strukturierte Bearbeitung des Erlebten zu ermöglichen. Die Teams vermitteln betroffenen Eltern zudem passende Unterstützungsangebote für die Zeit nach der Betreuung durch die Klinik. „Trotz der seelischen Wucht wird über das Thema kaum gesprochen – aus Unsicherheit, Angst oder Scham. Dabei zeigen unsere Erfahrungen, dass eine offene und fürsorgliche Kommunikation helfen kann, langfristige psychische Folgen wie Depressionen oder Angststörungen zu verhindern“, so Laister abschließend.
Service-Links: